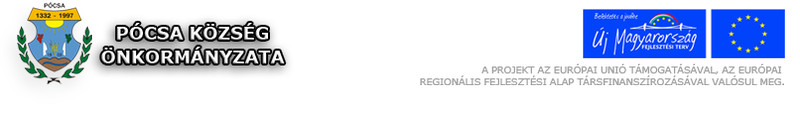Bei Anständigen ist das erste gemeinsam Erworbene das Kind. – lautet der Spruch. Die Kinder sollen eine Taufe, Taufpaten bekommen. In Pócsa und vielen anderen Orten wurden die Taufpaten nicht aus der Verwandtschaft, sondern aus dem Freundeskreis gewählt. Bei den Gevatterschaften, wo man sich gut verstand, bestandenen diese oft über Generationen hinweg, weil ihre Kinder wieder von einander den Gevatter auswählten.
Es gehörte sich nicht eine Anfrage zum Taufpaten nicht anzunehmen, egal ob der Anfragende reich oder arm war. Natürlich fragte der Ärmste auch nicht bei dem Reichsten an.
Es war eine große Ehre Patentante zu sein. Man sagte dazu auch: stolz gehen!
Es gehörte sich schon zwei oder drei Monate vor der Geburt des Kindes anzufragen. Damit war auch einberechnet, dass das Kind eventuell eine Frühgeburt wird. Es war selbstverständlich, dass die anderen Kinder der angefragten Familie einmal auch von den Anfragenden getauft werden sollten. Alle, egal wie viele es werden sollen. In Pócsa war es nicht üblich, dass jedes Kind andere oder mehrere Taufpaten hatte.
Mit der Geburt des Kindes fingen die Aufgaben der Gevatterin an. Am ersten Tag nach der Geburt – wenn die Geburt zu Hause stattfand –, oder am ersten Tag nach der Heimkehr aus dem Krankenhaus brachte sie das Frühstück. Dies bestand aus zirka zwei Litern Milchkaffe, einem Teller Gebäck und einem halben Liter Rum oder Likör. Ihnen standen noch zwei Sorten Biskuit, ein normaler gelber und einer mit Nüssen und eventuell Linzer Plätzchen zu.
Früher, als noch kein Biskuit gebacken wurde, nahm man Schneekugeln (sind in einer Form gebacken worden) oder Linzer Plätzchen mit. Die Gevatterin, in Festtagskleidung angezogen nahm dies eingepackt in dem schönsten, gestickten, mit Druckmustern geschmückten Tischtuch zu ihnen. Den Kaffee trug sie in einem neuen Kochtopf, weil er so nicht herauslaufen konnte, worauf noch ein Teller mit Kuchen kam. Das alles stellte sie in die Mitte des Tuches, band die Enden zusammen und trug es so. Mit dem Rum oder Likör (in der Flasche des Gläsersets für Spirituosen) in einer Hand, dem gebundenen Tischtuch, worin Kaffee und Gebäck waren in der anderen, ging sie los. Danach brachte sie der jungen Mutter (und Familie) drei Tage das Mittagessen. Für ein Mittagessen brachte man ein gekochtes Huhn, eine Fleischsuppe (mit kleinen quadratförmigen oder Fadennudeln) einen Teller Bratfleisch oder Schnitzel (für fünf bis sechs Personen), in den 60-er Jahren ein-ein Leib Brot (früher nur ein großes Leib Weißbrot, aber nur am dritten Tag), einen Teller Gebäck, zwei Torten, einen Liter Wein. Für das gekochte Fleisch nahm man noch Tomaten- oder Sauerkirschsauce mit.
Natürlich war an jedem Tag eine andere Sorte Gebäck auf dem Teller und die Torte hatte auch immer einen anderen Geschmack und eine andere Form. Es konnten zwei runde sein, oder Herz, Fisch, Glucke mit Kücken, sowie andere Formen auch. Natürlich waren diese sehr schön dekoriert, (manche haben sie in einem anderen Dorf, oder mit einem Konditor machen lassen) weil sie auf einer Tortenplatte, in der Hand durch das ganze Dorf getragen wurden (wenn sie nicht weit von einander weg wohnten), und es gab immer neugierige Leute, die einen anhielten, weil sie die Torte sehen wollten.
Das Mittagessen wurde in Körben getragen. Diese waren aus Weidenruten geflochten, lackiert und mit bunten gefärbten Blumen dekoriert. In die Körbe legte man ein Tischtuch, dann in die Mitte die Suppe (in einer Suppenschüssel oder Topf mit Deckel), worauf noch das gekochte Fleisch kam. Daneben wurden (damit auch nichts auslief) das Brot, die Soße, das Bratfleisch und der Wein verstaut.
Der Korb wurde mit einer verzierten Decke abgedeckt, die zwei Griffe angepackt, in der anderen Hand die Torte und so wurde das getragen. Weil eine Person das nicht alleine tragen konnte, half immer Mutter-, Schwiegermutter-, eventuell Schwester oder Bruder dabei. Die Hilfe benötigte man auch für das Backen des vielen Gebäcks. Wenn sie Zeit dafür hatten, wurde auch zurückgeholfen.
Unsere Großeltern organisierten die Taufe – als noch viele Kleinkinder gestorben sind – am Tag nach der Geburt. Damals gab es noch viele Kinder in den Familien, für lange Vorbereitungen gab es auch nicht viel Zeit, so wurde die Taufe im engen Familienkreis gehalten. Bis in die 50-er Jahre brachte man das Kind (mit einem Wagen oder einer Kutsche – was man hatte) nach Márok zur Taufe. In den 60-er Jahren änderte das sich so, dass die Taufe eine Woche nach der Heimkehr aus dem Krankenhaus am Sonntag schon in Pócsa gehalten wurde.
Die Patentante bekam ein neues Kleid (Kostüm). Als Geschenk nahm sie eine weiße Torte (Zitrone oder Vanille) und ein original weißes, seidenes Steckkissen. Sie musste schon eine Stunde vor der Messe los, weil die Mutter sie schon mit Spirituosen, Milchkaffee, Gulasch zum Frühstück erwartete. In die Messe gingen sie nur, als die Hälfte vorbei war, vor allem in Winter, damit das Kleinkind nicht nass wurde. Als wir losgingen, (die Eltern auch) gehörte es sich „Wir bringen einen kleinen Heiden, holen einen Christen!” zu rufen.
Vor der Taufe gehörte es sich mit dem Kind in die Sakristei zu gehen, da es noch „heidnisch” war. Nach der Taufe durfte man durch den Haupteingang nach Hause gehen.
Die Arme des im Steckkissen liegenden Kindes waren beim Ellenbogen eingebogen. Es musste waagerecht getragen und während des Taufvorgans gehalten werden, damit das Steckkissen keine falten bekam. Die Steckkissen unserer Großmütter waren mit schöner Spitze geschmückt, bei einem Jungen mit einen blauen, bei einem Mädchen mit einen eingeflochtenen rosa Band.
In den 1960-er Jahren waren die Taufe und das Segnen der Mutter noch nach der Messe. Das macht man heute schon während der Messe. Früher hatte man die Mutter dann gesegnet, als sie ihr Kind das erste Mal in die Kirche brachte (vorstellte), weil sie am ersten Tag nach der Geburt noch nicht zur Taufe gehen konnte. Für die Taufe musste man nicht bezahlen. Die Namen wurden bis zu den 50-er, 60-er Jahren noch so gegeben, dass der erstgeborene Junge und das erstgeborene Mädchen die Namen der Pateneltern bekamen. Es gab Ärger, Gevatterschaften zerstritten sich, wenn nicht diese Namen gegeben wurden.
Für das Mittagessen scheute die Familie des Kindes keine Mühe. Viel gebratenes, gekochtes Fleisch, Suppe, Torte und Gebäck kam auf den Tisch. Während und nach dem Essen unterhielt man sich, hielt das Kind auf den Arm – es wurde schon Abend als der Gesprächsstoff ausging. Dann war es vorbei mit dem Feiern.
Solange der Patensohn/die Patentochter in die Schule ging, bekam er/sie zu Weihnachten und Ostern Geschenke von den Pateneltern. Das erste und das letzte Geschenk waren anders als die anderen. Das erste Geschenk bekam das Kind beim ersten Anlass nach der Geburt (wenn es vor Ostern geboren ist, dann zu Ostern, wenn vor Weihnachten, dann zu Weihnachten).
Zum ersten Anlass bekam es (außer den anderen Geschenken) ein Kleidungsstück (den Stoff), das dann genäht wurde, als es ein Jahr alt wurde. Ein kg Würfelzucker kam noch dazu.
Beim nächsten Mal war das Geschenk: vier Tüten Lebkuchen, eine Puppe – bei Jungen ein Pferd oder Husar auch aus Lebkuchen, fünf Äpfel, zwei Orangen, eine Tafel Schokolade, ein kleines Spielzeug. Das Geschenk bekamen sie immer am ersten Feiertag von Ostern oder Weihnachten. Früher nahm die Patentante diese vor der Litanei mit, dann kam nach der Litanei die Gevatterin zu ihnen. Das ist schon vor Langem verändert worden, sodass die Pateneltern beide zum Abendessen gingen. Sie gingen bei Dämmerung und blieben bis spät in die Nacht, weil sie ja zum Abendessen eingeladen wurden.
Das Menü: Gulasch, gebratenes, gefülltes Fleisch, Schnitzel, an Weihnachten auch frische Füllung. Danach gab es noch Torte, Gebäck, eingekochtes Obst, Kaffee, Wein und andere alkoholfreie Getränke. Die kleineren Kinder blieben bei der Großmutter, wenn sie schon zur Schule gingen konnten sie auch kommen. Die Kinder konnten das Weggehen kaum erwarten, aber sie waren noch viel mehr aufgeregt, als ihre Pateneltern zu ihnen kamen. Ab der fünften Klasse bekamen sie statt Spielzeug Bücher, Schals, Handschuhe, Pullover als Geschenk. Das letzte Geschenk war – außer einer Puppe, Äpfel und Schokolade – Kleidung oder Stoff für Kleidung, Besteck, eventuell irgendein Set. Als auch das kleinste Patenkind fertig war mit der Grundschule, bekam es das letzte Geschenk der Pateneltern. An Ostern bedankten sich die Eltern und das Kind bei den Pateneltern, damit war dann Schluss mit dem Gäste-Sein, was den Kindern keine große Freude bereitete. Die Freundschaft blieb, sie besuchten einander nachher, aber dieser Zauber ging verloren.
Zur Firmung fragten wir in erster Linie auch bei den Pateneltern an. Es kam selten vor, dass jemand andere Firmeltern wählte. Bei der Firmung stand die Patentante hinter der Patentochter, der Patenonkel hinter dem Patensohn. Diese Ehre ging auch mit einem Geschenk einher. Das Geschenk durfte nicht irgendetwas sein, meistens war das eine Halskette aus Gold, Armbanduhr, Bibel usw.. Der Kirche musste man auch für die Firmung nichts zahlen. Die Kinder wurden erwachsen, heirateten und die Pateneltern bekamen eine andere Rolle erteilt. Sie halfen bei den Hochzeitsvorbereitungen. Am Hochzeitstag war der Patenonkel besonders geehrt. Er führte die Braut (oder den Bräutigam) aus dem Haus. Er war auch der Zeuge. Nach dem jungen Paar und den Brautjungfern mit Brautführern war er der erste in der Reihe (zur Kirche und auch zurück). Ihm gebührte der Platz neben dem Ehepaar am Tisch. Die Übergabe der Geschenke fingen auch die Pateneltern (mit dem größten Geschenk) an.
Die letzte Aufgabe der Gevatterschaften war bei der Beerdigung. Beim Tod ihrer Eltern gab der Gevatter den Ministranten Geld, trug die schwarze Flagge. Die Gevatterin ordnete um herum der Totenbahre die Kränze, übergab dem Pfarrer, dem Kantor die Kerze, sie band das schwarze Band an das große und kleine Kreuz, an die Fahnen und die Arme der Totengräber. Nach dem Ende der Beerdigung bat sie mit aufmunternden Worten die trauernde Familie das Grab zu verlassen.